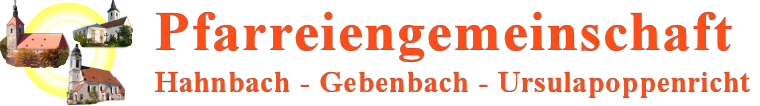Dr. Josef Weiß-Cemus und Hahnbachs Heimatpflegerin Marianne Moosburger ist es nach langen Recherchen gelungen, gleich mehrere Geheimnisse in und an der Hahnbacher Friedhofskirche zu lüften.
Rätselhaft war bislang, wie das nachweislich 100 Jahre ältere Sandsteinrelief an der Außenmauer der Friedhofskirche zur Straße zum bislang angenommen Kirchenbau Ende des 16. Jahrhunderts passen soll. Die dort dargestellte Szene mit Jesus am Ölberg konnte nämlich schon immer sicher auf das frühe 15. Jahrhundert datiert werden. Der Bau der Kirche aber wurde erst im späten 16. Jahrhundert vermutet.
Auch für Dr. Heribert Batzl war Relief und dessen Platzierung zeitlebens ein Rätsel. Er hatte in seiner Chronik Hahnbachs vermutet, dass es vielleicht von der Pfarrkirche stammen könnte. Doch wurde dies zu Recht immer wieder angezweifelt. Denn hierfür gab es keinerlei Belege und es ließen sich auch an der Pfarrkirche selbst bei aufwändigem Innen- und Außenrenovierungen keinerlei Spuren eines entfernten Reliefs finden.
Die Frage nach der Bauzeit des kleinen Kirchleins blieb zudem bislang unbeantwortet. Es wurde sogar vermutet, dass der Bau der Friedhofskirche erst in der Zeit der Rekatholisierung, also nach 1628, errichtet wurde. Als frühestes Datum seines Baus setzte man die Zeit um das Aussiedeln des Friedhofs aufgrund einer Pestepidemie, also nach 1582/3, an.
Doch der aus Dürnsricht bei Hahnbach stammende Historiker Dr. Josef Weiß-Cemus fand nun zuerst eine „Vogelkarte“ von 1603, die ein Kirchlein vor dem oberen Tor mit einer kleinen Einfriedung zeigt, also deutlich vor der Rekatholisierung im späteren 17. Jahrhundert.
Ausschlaggebend für eine Neudatierung der Friedhofkirche war aber schließlich, dass sich im Regensburger Bischöflichen Zentralarchiv unter Pfarrarchiv Hahnbach Nummer 415 ein Schreiben des kenntnisreichen Historikers und Pfarrers Franz Seraph Kutschenreiter fand.
Dieser schreibt sachkundig am 6.2.1903 an den Bischof von Regensburg, dass „die gotischen Spuren an den Fenstern, sowie die tiefe Lage in dem umliegenden Friedhof, der 1582 aus Anlass einer Pest angelegt wurde, für ein höheres Alter der Friedhofskirche sprechen. Ebenso das kleine Steinrelief an der Westseite.
Somit stammen wohl Friedhofskirche samt Steinrelief höchstwahrscheinlich bereits aus dem 15. Jahrhundert. Damit ist das Kirchlein wohl mehr als 100 Jahre älter als bisher angenommen.
Auch die Inneneinrichtung und ihre Geschichte warf mehrere Fragen auf. So wusste man, dass das Kirchlein unter den calvinistischen Kurfürsten nachweislich „gänzlich ausgeräumt“ worden ist. Zudem findet man in den Pfarrakten den Hinweis von 1842 über eine „völlige Verwüstung des Kirchleins, dem der Einfall droht“ nach der Zeit der napoleonischen Kriege. Damals diente die Friedhofskapelle als Magazin für Heu und Stroh. Von einer Einrichtung, einem Altar, Bildern oder Bänken ist keine Rede.
Auch Hahnbachs erster Heimatpfleger Ludwig Graf verwies immer darauf, dass offensichtlich der Hauptaltar einmal höher gewesen sein müsse, da er sichtlich oben abgeschnitten wurde und somit augenscheinlich nicht für diese Kirche angefertigt wurde.
Nun fanden sich im Bischöflichen Zentralarchiv Nachweise, dass die Hahnbacher nach der Säkularisation, der Verstaatlichung der Kirchengüter, von 1802/3, im Jahr 1812 „die mit schön geschnitzten Köpfen versehenen Betstühle aus der Paulanerkirche zu Amberg“ für diese Kapelle erworben haben. Ein guter Teil davon findet sich auch bis heute im hinteren Teil der Frohnbergkirche und weitere bekam damals laut Aktennotiz die Friedhofskirche.
Der Pfarrer und Historiker Franz Seraph Kutschenreiter bemerkt, dass wohl auch der „Zopfaltar“ aus jener Klosterkirche der Paulaner stammt. Weiter findet man im Pfarrarchiv, dass die Sollnhofer Schieferplatten auf dem Boden des Kirchleins von Sankt Martin in Amberg günstig erworben wurden. Damals wurden ja, wie schon unter den calvinischen Kurfürsten, die Inneneinrichtungen von Kirchen und Klöstern preisgünstig an die Meistbietenden versteigert, bzw. besser gesagt „verscherbelt“.
Auch konnte nun manch weitere Inneneinrichtung erklärt werden. So wird das große steinerne Becken unter der Empore in den Pfarranalen als „profiliertes Weihwasserbecken“ definiert und war damit wohl nie, wie ebenfalls wiederholt vermutet wurde, ein Taufbecken.
Auf alten Zeichnungen von 1835 und 1850 entdeckt man zudem, dass der Eingang zum Friedhof nur über die Kirche möglich war. Südlich davon wird offensichtlich eine Statue oder ein Andachtsbild durch einen knienden Beter verehrt. Auch die Nische mit dem Märtyrer Sebastian fehlt dabei, die übrigens aus Kümmerbuch oder Kötzersricht stammen soll.
Der Hahnbacher Pfarrer Martin Eidenschink, der „energisch Ordnung schaffte“, stellte 1902 sogar einen Antrag auf Abriss der Friedhofkirche. Doch das Regensburger Ordinariat und die Hahnbacher verwehrten ihm dies strikt. Wohl auch als Gegenreaktion auf die „Empfehlung“ des Pfarrers begann Josef Graf, Hausname „Krausen“, von der Haunummer 71, damals ohne zu fragen, auf eigene Faust und ohne Bezahlung, jedoch mit dem Placet des Bürgermeisters Josef Trösch, die Kirche innen zu ausweißen. Dies brachte ihm prompt eine Anzeige des Pfarrers wegen „Hausfriedensbruch“ ein. Doch offensichtlich blieb das Kirchlein bestehen.
1905 setzte jener Pfarrer Eidenschink durch, dass der Haupteingang zum „besseren Verschluß des Friedhofs“ verlegt wurde, eine eigene Friedhofsordnung aufgestellt und der, seiner Meinung nach, „schlampige und eigensinnige Totengräber“ ernstlich verwarnt wurde.
Um 1933 war es schließlich Hahnbachs Pfarrer Friedrich Schrembs, der eine „gründliche Instandsetzung“ und auch das Graben eines eigenen Brunnens veranlasste. Seitdem gilt Hahnbach Friedhofs als einer der gepflegtesten und schönsten „weit und breit“, und das nicht nur zu Allerheiligen!
 |
| Alte Zeichnung der Friedhofskirche mit Eingang vorne. |
 |
| Der Altar im Innenraum |